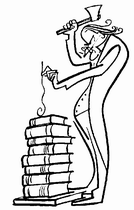Was
ich damit schon immer sagen wollte!
Redensarten
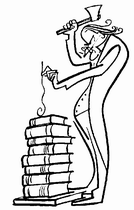
Chr.-Fritz
Prüßner
Hannover, 1999
Was ich damit
schon immer sagen wollte! *
Mensch
und Natur im Widerstreit *
Oder:
Ick bin jerührt wie Appelmus!
Die
"Eintracht" bestellt ihr Haus *
Literaturnachweis:
Krüger-Lorenzen "Deutsche
Redensarten – und was dahinter steckt"
VMA-Verlag Wiesbaden, 1960
A.J. Storfer "Wörter und ihre
Schicksale"
Verlag "fourier", Wiesbaden 1981
Hansel Weigel "Die Leiden der jungen
Wörter – ein Antiwörterbuch"
dtv-Taschenbuch 1976
Leo Sillner "Gewußt woher,
Handbuch der Herkunft deutschsprachiger Wörter und Redensarten."
Deutscher Bücherbund Stuttgart,
1973
Mackensen, "10.000 Zitate, Redensarten,
Sprichwörter"
Verlag Werner Dausien, Hanau, 1981
Kriminalmuseum Rothenburg o.T. "Rechtssprichwörter
und sprichwörtliche Redensarten mit rechtlichem Inhalt"
Rothenburg, 1992
Diese Broschüre entstand im Zusammenhang
mit einem Referat in der Gruppe "Männerwerk" Eldagsen am 5.2.1999
– Eine Vervielfältigung des Textes ist nur mit ausdrücklicher
Genehmigung des Autoren gestattet.
© Chr.-Fritz Prüßner
– postfach 3024 – d-31821 springe
Was
ich damit schon immer sagen wollte!
Redensarten
-
"Was ich Schwarz auf Weiß besitze, das kann
ich getrost mit nach Hause tragen" richtig und so wollte ich es heute
auch "halten", wenn ich mich allein auf meinen Kopf verlassen wollte, -
also gibt es für mich als Hilfe ein Konzept.
Aber schon dieser Hinweis auf das Wort auf Papier
ist ja eine Redensart, dazu noch eine recht prominente. Sie stellt ein
Zitat dar und stammt aus Goethes "Faust" (1790).
-
Redensarten haben einen Hintersinn. Sie fassen in scheinbar
kurzen Worten eine Lebenserfahrung zusammen und damit schwebt in den Redensarten
oft genug auch so eine Art Erfahrungsgesetz mit.
Wahrscheinlich ist dieser Satz aus Goethes Feder
schon aus viel älterer Zeit, denn wenn man sich in unserer Sprache
ein wenig umhört, dann finden wir ihn in abgewandelte und sogar strengerer
Form wieder, wenn es zum Beispiel heißt: "Schwarz auf Weiß
behält seinen Preis" – oder in der niederdeutschen Mundart: "Wat
schrift, blifft!". Und erkennbar wird, daß hier von einer Art
Vertrag die Rede ist, auf das, was geschrieben wurde, kann ich mich verlassen,
berufen. Und wie weit das reicht, wird aus einem Sprichwort erkennbar,
das schon unsere Umgebung verlassen hat: "Schwarz auf Weiß redet
noch, wenn’s niemand mehr weiß." Obwohl diese Redensart kaum noch
Gebrauch findet, so müssen wir doch immer wieder feststellen, wie
wirklich diese Erkenntnis ist. Längst vergessene Schandtaten werden
beim Sichten von scheinbar harmlosen Archiven auf einmal sichtbar und dem
noch lebenden Übeltäter zum Verhängnis, ein längst
vergessenes Testament wird nach 190Jahren (wie vom Erblasser vorgesehen)
geöffnet und zur Wohltat für viele Menschen, die in Armut leben.
-
Und wenn es sich bei dem ersten Beispiel noch um relativ
leicht erkennbar Bezüge handelt, so gibt es in unserem Sprachschatz
durchaus auch Redewendungen, die scheinbar ein Geheimnis in sich bergen.
In einem Gemeindegruß entdeckte ich in den 70er Jahren bei der Liste
der Gottesdienste folgenden Satz: "Die Prediger des jeweiligen Sonntags
hängen am schwarzen Brett aus." – das kann einem schon
mal passieren. Aber das schwarze Brett ist ja ohnehin verbreitet. Aber
woher kommt es – selten genug ist es ja wirklich schwarz. Im Mittelalter
gab es in einigen Teilen des heutigen Deutschlands die juristische Vorgehensweise,
daß im (oder auch: am) Rathaus eine schwarze Tafel hing, Auf dieser
Tafel wurden die Bürger notiert, die sich zum Beispiel einen Tadel
eingehandelt hatten. Auch Strafverfahren wurden an einigen Orten auf diesem
Brett öffentlich gemacht. – Da auch gleichzeitig Register geführt
wurden, in denen diese Notizen "auf ewig" festgehalten" wurden,
nannte man sie das "schwarze Buch" oder auch das "schwarze Register".
Bis in unserer Zeit hat sich dieser Begriff bewahrt, wenn zum Beispiel
aus welchem Anlaß auch immer ein "Schwarzbuch" zu einem bestimmten
Themenkomplex herausgegeben wird; gewissermaßen eine Klageführung.
-
Redensarten haben einen weiteren Zweck. Sie sollen in
einer scheinbar stenografischen Wortwahl, verpackt in bildreichen Worten
einen komplexen Umstand beschreiben und auf die zu erwartenden Folgen hinweisen.
Es wird dann davon ausgegangen, daß jeder das gewählte Bild
versteht und sich alles andere selber ausmalen kann.
Wer von uns ist nicht schon mal jemandem (versuchsweise)
"auf’s Dach gestiegen", ohne daß er Schornsteinfeger oder
Dachdecker ist. Ich gebe gerne zu, daß ich selber überrascht
war, als ich erfahren mußte, daß sich dahinter ein mittelalterlicher
Rechtsbrauch erkennen läßt. Wenn in einem Ort jemand lebte,
der es mit aller Gewalt darauf anlegte, sich mit allen Menschen um sich
herum anzulegen und damit für Unfrieden sorgte, dann wurde ihm tatsächlich
ein Verfahrten "an den Hals gehängt" (schon wieder eine Redensart),
und nach festgestellter Schuld, stieg man ihm auf’s Dach und im günstigsten
Fall wurde das Dach "nur" abgedeckt. Wenn er es zu arg getrieben hatte,
war das nur der Beginn für den kompletten Abriß des Hauses.
Ein interessanter Nebenzug entwickelte sich im Blick
auf die Ehe-Führung. So konnte es einem Ehemann passieren, daß
man Ihm auf’s Dach stieg, weil er sich von seiner Frau schlagen ließ.
-
Selbst das "an den Hals gehangen" bekommen, ist
wieder ein Hinweis auf den Umgang in der Rechtsprechung. Es war eine von
vielen kleinen entwürdigenden Strafen, wenn man einem alten Lästermaul
eine oder zwei Glocken an den Hals hing. Für eine bestimmte Zeit mußte
dann diese klobige und damit sehr lästige Schmuck in der Öffentlichkeit
getragen werden. Bei jeder Bewegung bimmelte es und jeder in der Stadt
wußte, mit was für einer Person er es hier zu tun hatte. In
Deutschland ist dieses "etwas an den Hals hängen" noch bis 1945 vorgekommen;
besonders im Zusammenhang mit den Verfolgungen bei sogenannten "Rassevergehen"
und während des Krieges bei "wehrkraftzersetzenden Straftaten" mußten
die Delinquenten Schilder mit sich tragen, auf denen ihre Verfehlung geschrieben
stand.
-
Über das tatsächliche Alter von einzelnen
Redensarten gibt es wohl niemals wirkliche Gewißheit. Wie auch, wir
müßten nur einmal uns selber aus der Distanz beobachten und
zuhören dürfen, wir könnten feststellen, daß dann
und wann uns Erkenntnis kommen, die wir in Worte zusammenfassen. Kleine
"Aha-Erlebnisse", und wenn es ein kurzer griffiger Satz ist, dann prägt
er sicb bei uns ein, vielleicht übernimmt ihn einer unserer Mitmenschen
und so zieht er seine Bahn, aber wie oft wiederholen sich auf der Erde
solche Aha-Erlebnisse und darum kann es eben auch vorkommen, daß
mir dann jemand auf meine Entdeckung entgegnet, das haben schon die alten
Römer gewußt: Denn wenn Sie "den Nagel auf den Kopf treffen"
konnten, dann ist das zwar keine besonders stolze Leistung, sollte man
meinen, aber bereits um 200 vC. wird diese Redensart in einem Lustspiel
aufgeschrieben. Oder wem ist eigentlich in unserer Sprechwelt bewußt,
wieviele der Redensarten und Sprichwörter (Spruchweisheiten) ihren
Beleg schon im Alten Testament haben. Nicht jeder ist eben eine Taufbauarbeiter,
der "anderen eine Grube gräbt!", aber es kann auch diesem passieren,
daß "er selber in diese Grube fällt" (Sprüche 26,27).
– Wobei die Wurzel dieser Spruchweisheit ganz interessant ist. Heute müssen
wir an die Tiefbauarbeiten und den Bergbau denken. Im Mittelalter waren
es vielleicht die Abfallgruben. Aber gehen wir noch viel weiter zurück,
dann kommen wir durchaus bis in den Bereich der Jagd.
-
Aber durchaus auch aus ganz anderen Lebensbezügen
entwickelten sich die Redensarten und wenn man sich dann ihren Ursprüngen
nähert, wird einem auch der Ernst bewußt, der sich hinter den
Worten eher deutlich als verschwommen erkennen ließ. Wir "hören
heute ja eher die Engel im Himmel singen" und meinen damit ziemlich
genau das Gegenteil, wenn einem die Zahnschmerzen mal wieder voll auf den
Nerv gehen. Doch geht man dieser Bemerkung nach, dann kommt man wieder
in das Mittelalter mit seinen Stadtmauern und ähnlichen Befestigungen.
Und dazu gehörten dann auch die Stadtmusikanten und die Nachtwache
oder der Nachtwächter. Bei Gefahr mußten sie die Bürger
alarmieren und das so wirkungsvoll wie irgend möglich. An vielen Orten
wurden die Stadtmusiker auch "Stadtpfeifer(ei)" genannt und wenn sie aufspielten,
dann sprachen die Menschen nicht vom "spielen", sondern vom "pfeifen".
Und so hörten damals die Menschen in den Städten "das Pfeifen
der Engel vom Himmel" und es war vielleicht schaurig anzuhören,
aber es war ihnen gewissermaßen die Chance zur Abwehr von Gefahr.
– Daß unser Körper mir den Schmerzen ähnliche Signale ausposaunt,
wird dann auch erst wieder bewußt – Schmerzen nicht als Gemeinheit
oder Zumutung, sondern als Warnung!
-
Fein verborgen bleiben manch merkwürdige Redewendungen,
weil ihr Ursprung in einem tatsächlich recht engen Zirkel zu suchen
ist. Und doch, wenn man’s nach der Entdeckung genau bedenkt: "Genau – richtig!"
– Wie oft haben wir in den unterschiedlichsten Zusammenhängen schon
vom "Schema F" gesprochen. Wenn ich jetzt noch von der "Ablage
P" spreche, dann bezieht sie sich nicht unbedingt auf meinen Familiennamen,
sondern auf den Papierkorb. Was ist ein Schema – genau genommen ein Formular,
ein Vordruck, eine vorgeschriebene Art. Und so ist es auch mit dem "Schema
F", ursprünglich wurde von dem "Formular F" gesprochen und dieses
Formular gab es tatsächlich, denn in ihm wurde geregelt, wie die preußischen
Soldaten einen Frontbericht (Rapport) zu verfassen hatten.
-
Doch auch in Sachen Humor bleiben in den Redewendungen
einige Geheimnisse. Wie es dazu kommen konnte, daß wir manchen Menschen
nachsagen, sie hätten "einen Schalk im Nacken", bin ich nicht
all zu weit gekommen. Die Bedeutung ist klar, denn wir beschreiben dann
damit einen Menschen, der einen immer wieder überraschenden Humor
hervorbringen kann. Daß dieser Schalk da und dort auch "auf der
Schulter" sitzt, erschwert die Suche nach der Erklärung nicht,
aber hilft eigentlich auch nicht weiter. Denn das Bild beschreibt ja eine
Außenwirkung, die man diesem Menschen zuschreibt. Der Humor wird
ihm zugeflüstert. Die Berliner Schnauze hat das dann ja mir "dem
kleenen Mann im Ohr" noch auf die Spitze getrieben! – Vielleicht ist
es ein Bild von dem Hofnarr, das hier mehr spöttisch eingebracht wird...
-
Auch Fehleinschätzungen lassen sich in Redewendungen
entdecken. Wenn es zum Beispiel heißt, daß der Sowieso gestern
Abend "alles durch den Kakao gezogen" hat, dann will das ja soviel
besagen wie: Der Sowieso hat entweder nicht alles ganz ernst genommen oder
er hat alles durch den Dreck gezogen, schlecht gemacht. Vielleicht
liegt es daran, daß Kakao eine lange Zeit zwar ein wertvolles Produkt
aus der fernen anderen Welt war, aber seine braune Farbe und in flüssiger
Form als undurchsichtiges Getränk mehr eine mindere Bedeutung bei
den meisten Menschen hatte. Lange Zeit war es ja auch als ein angeblich
harmloses Kindergetränk im Gebrauch... Und dann der angeblich schmutzige
Kindermund nach einem guten Schluck... Was gemeint sein soll, mit dem "durch
den Kakao ziehen" wissen wir wohl, aber keiner würde es in Wirklichkeit
tun.
-
Ein makabres Wort – viel benutzt in der letzten Zeit
– ist mir aufgefallen, wenn von den Fußballspielen die Rede ist,
bei denen mit vielen "Schlachtenbummlern" zu rechnen sei, oder daß
diese unangenehm auf sich aufmerksam machten – Das hat es schon im Deutsch-französischen
Krieg 1870/71 gegeben – man muß sich das mal vorstellen: Zivilisten
gingen in die Front und sahen dem "Treiben auf dem Felde" zu – wie nennt
man das eigentlich heute? Fernsehzuschauer würde sich anbieten und
die Sache wunderbar treffen – wer weiß, vielleicht wird man dieses
Wort in 100 Jahren auch so ungewohnt wieder finden, wenn es um dann anstehende
Sportereignisse geht!
-
Was ist eigentlich aus dem Deutschen Michel geworden?
Seit einiger Zeit ist er – so scheint es – kein Gesprächsthema. Warten
wir es ab, wann es wieder so weit ist. Und woher kommt diese urteutsche
Nationalfigur?
Gab es ihn? – Nnnnjein!
Eigentlich nicht? Denn am Anfang dieses Wortbildes
stehen zwei Zufälligkeiten. Im Mittelalter wurden ganz viele Kinder
auf den Namen Michel getauft, der sich ableitet von "Michael" und in seiner
hebräischen Übersetzung soviel heißt wie: "wer ist gleich/wie
Gott" (und damit auch: "Er kommt Gott ganz nahe!"). Im Mittelhochdeutschen
bedeutet das Wort "michel" aber auch "Stark" und "Groß" (Städtenamen!).
Dann kommt dazu das häufig selbst überschätzte Gefühl
der Stärke und Macht der (selten sich einigen) Deutschen. Und so kam
bald von Außen das erste Mal mehr spottend das Gegenbild zu dem starken
Michel, von dem etwas verträumten schläftigen Typen mit der Zipfelmütze.
Auch von innen bekam die Karikatur mehr und mehr eigenes Leben, als zum
Beispiel 1541 ein gewisser Sebastian Franck schrieb: Ein rechter dummer
Jan (Dummerjan) der teutsch Michel. Bis dann im 17ten Jahrhundert für
lange Zeit sich dieser Titel mehr in eine Ehre zu verkehren beginnt. Der
damals als Held verehrte Reiteroberst Hans Michael von Obentraut (Denkmal
in Seelze), der im 30jährigen Krieg große Erfolge für
die Truppen der Union erzielte (und dann selber 1625 ums Leben kam)
macht mit seinem Namen diese Kehrwende aus, damals wird sogar vom "Michael
Germanicus" gesprochen. Ab etwa 1848 wandelt sich das Bild dann wieder
hin zu einer Karikatur.
-
Leicht schmunzeln mußte ich, als ich mich einmal
auf die Suche nach der Bedeutung des netten Satz machte, in dem es um das
merkwürdige Wort "Schlawittchen" geht; "Jemanden am Schlafittchen
fassen" besagt ja zunächst einmal, ihn festhalten, auch bei der
Festnahme kann diese Redewendung in der Umgangssprache (selbst bei heutigen
Richtern) wieder gefunden werden. Und ehrlich, bis zu der Entdeckung der
Bedeutung habe ich dieses merkwürdige Wort auch immer wieder falsch
geschrieben – mit "w" – Und dann die Reise zu der Bedeutung: Dem Schlafittchen
fehlt ein Buchstabe, das "g" denn richtig hätte sich durchsetzen müssen
als "Schlagfittchen", und damit wird die Verniedlichung des Schlagfittichs
– des kleinen Flügels schneller erkennbar. Wer mit Geflügel auf
seinem Hof zu tun hat, hat die Gans oder das Huhn sicherlich schon mal
am Schlaffitich gefaßt. Damit wäre ja eigentlich schon alles
klar – wenn da nicht auch noch diese seltsamen Rockschösse wären,
bei denen man ja auch "Flügeln" spricht und da kann man dann auch
zufassen.
-
Wenn im Rat wieder mal eine Verhandlung ausgegangen
ist wie das Hornberger Schießen, dann sollte man sich einmal
das schöne Hornberg im Schwarzwald vor Augen führen. Hoch über
der Stadt die alte Burg. Ein enges Tal, zwei noch engere Seitentäler.
– Da soll folgendes geschehen sein:
-
Der Herzog von Schwaben hatte seinen Besuch angekündigt;
und die Hornberger übten das Böllerschießen so sehr, daß
sie kein Pulver mehr hatten, als der hohe Herr wirklich kam..
Das ist die eine Variante, und wie wäre es
mit der folgenden?
-
Auch in ihr kommt der Herzog zu Besuch, Späher
sollen sein Ankommen rechtzeitig den Bürgern melden, damit man sich
gut und pünktlich auf die Ankunft einstellen kann und die Böller
rechtzeitig abfeuern kann. Aber die Späher hatten wohl einen eher
getrübten Blick und meldeten immerfort andere Wagen, als die des Herzogs,
also gab es immer und immer wieder vergeblichen Salut und als er dann endlich
kam – war nichts mehr da, das Pulver war verschossen.
(Schon wieder eine Redwendung)
Aber nicht genug mit dieser Variante, Hornberg eignet
sich scheinbar für mehrere Überlegungen, somit hier eine weitere
Version des Geschehens:
-
Die Hornberger veranstalteten
ein Preisschießen – Schützenfest
würden wir sagen oder noch konkreter in Eldagsen: Freischießen.
Für das Fest wurde viel Aufwand betrieben
und sehr viele Gäste eingeladen. Und dann begann das Fest und das
Schießen sollte angehen, und dann war kein Pulver da, man hatte es
vergessen.
Nein, keine falschen Befürchtungen, das Hornberger
Schießen kann auch ganz anders ausgegangen sein, zum Beispiel auf
diese Art und Weise:
Es gab Krieg zwischen Villingen und Hornberg, die
Hornberger aber schossen dabei so schlecht, daß sie sich ergeben
mußten.
-
Worauf die Redensart wirklich zurück geht - wollen
nicht einmal die Hornberger wissen, denn alle haben sie etwas für
sich und wenn es noch weitere Varianten geben sollte, man wir sie dort
gerne einbürgern. So klein der Ort zwischen Villingen und Offenburg
ja sein mag, aber man kennt ihn und wenn man auch nie so recht weiß,
was man mit dem Ausgang des Hornberger Schießens ausdrückt –
vielleicht ist es ja genau das Hornberger Schießen.
-
Nun sollten wir aber allein wegen der vielen Sprüche
nicht zu schnell den Kopf verlieren – schon wieder so eine Redensart,
die es in sich hat. Daß es sich dabei um einen wahrlich makabren
Hintergrund handelt, wird sich wohl jeder inzwischen denken können.
Mit ist nicht bekannt, seit wann es zu den allseits beliebten Grausamkeiten
unter den Menschen gehört sich gegenseitig den Kopf abzuschlagen,
aber allein schon die Vielzahl der Varianten läßt ahnen, welche
zwiespältige Gefühle damit in dem angesprochen werden (sollen),
wenn es heißt, Paß bloß auf, daß Du Dabei nicht
"Deinen Kopf verlierst".
-
Wie bunt aber auch im Blick auf unseren Kopf die Redensarten
sind, wird deutlich aus den Zeilen des "Briefes eines empörten Ehemannes
an den Verehrer einer Frau
"Sehr geehrter Herr!
– Ich muß Ihnen heute einmal energisch den Kopf waschen! Ich
zerbreche mir schon tagelang den Kopf und es will mir einfach
nicht in den Kopf hinein, warum Sie sich eigentlich in den Kopf
gesetzt haben, meiner Frau den Kopf zu verdrehen. ; ausgerechnet
Sie, dem doch schon der Kopf durch die Haare wächst! Ich weiß,
meine Frau ist von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Aber
Sie können sich auf den Kopf stellen, ich werde es nicht dulden,
daß sie beide die Köpfe zusammenstecken. Man tanzt und
trampelt mir auf dem Kopf herum, und jetzt wird mir auch noch auf
den Kopf gespuckt. Das macht mich ganz kopflos! Wie können
Sie mich überhaupt so vor den Kopf stoßen? Ich muß
Ihnen wohl erst einmal den Kopf zurechtrücken, denn sie scheinen
mit dem Kopf durch die Wand zu wollen. Aber sie haben allen ernstes
vergessen, daß ich nicht auf den Kopf gefallen bin. Meiner
Frau habe ich bereits auf den Kopf zu gesagt: "Ich will dir wegen
dieser Sache nicht gleich den Kopf abreißen", habe ich ihr
gesagt, "aber diesen Kerl schlag Dir mal aus dem Kopf!" Nun sitzt
sie da mit einem dicken Kopf und läßt den Kopf hängen.
Ihnen aber, mein Herr, rufe ich allen ernstes zu: Es geht um Ihren Kopf,
- verlieren Sie nicht den Kopf, sondern ziehen Sie schnellstens
Ihren Kopf aus der Schlinge. Sie werden sich sonst den Kopf einrennen
und dann sitzen Sie da mit einem Kopf, wie ein Feuermelder, - so
rot! – ich aber, merken Sie sich das, behalte den Kopf oben,
denn Gott sei Dank: Ich habe Köpfchen!
-
Ganz aktuell hörte ich kürzlich, wie ein gewisser
Kurz Felix ("Versteckte Kamera" u. "Verstehen Sie Spaß?")
von sich sagte: er habe eigentlich die Idee mit dem Lockvogel von
ihm stamme. Ich konnte ihn nicht fragen, wie wörtlich er das meint.
Aber bereits im Buch Sirach– also in unserer Bibel wird dieses merkwürdige
Tier in Gestalt einer schönen (jungen) Frau eingesetzt und genauso
benannt; Leere Versprechungen und das Wecken von Begehrlichkeit waren schon
damals ihre Aufgabe – wie heute die Lockvogelangebote der Geschäftswelt.
Und dabei ist die Jagd nach den Kunden ziemlich das gleiche Ziel - wie
früher das Ziel des Jägers war, eine fette Beute mit einem getürkten
Vogel zu erzielen.
-
Und wie schnell man aus einem Mißverständnis
eine Regel werden lassen kann, wird in der scheinbar ganz und gar klaren
Redewendung "Die beiden stecken unter einer Decke" deutlich! – Deutlich
ist das Wort schon – aber es hat zwei Gesichter:
- das eine von heute: Die drei da stecken unter
einer Decke! Sie bilden eine Art Komplott, die haben ein gemeinsames Geheimnis,
an die ist schwer ranzukommen...
und das andere aus älteren Zeiten, und wieder
sind wir in der Welt der Juristen gelandet, nämlich bei der Eheschließung.
Das war in alten Zeiten ja nicht unbedingt ein Akt der gegenseitigen Zuneigung
und der eigenen Willensentscheidung der beiden zukünftigen Eheleute,
sondern da mischten ganz andere Personen sehr verantwortlich mit. Erst
wenn über die beiden zu Vermählenden die Decke gelegt wurde,
sie also "unter der Decke steckten", dann waren sie mit einander
rechtlich verbunden. Und dieses taten sie nicht von sich aus, sondern es
wurde von anderen getan.
Und weil wir grad bei der Ehe sind...
-
Wie es das überhaupt mit den Pantoffelhelden,
oder wenn jemand unter dem Pantoffel des anderen steht? – Es ist
ein Bild, das in den Bereich der Ehe und Lebensgemeinschaft gehört,
soweit hat sich eigentlich nichts geändert. Nur heute stellen anderen
nach einer gewissen Zeit der Beobachtung fest, die oder der steht unter
dem Pantoffel dieses oder jener. – Abgeleitet wird dieses Bild aber von
einem der vielen seltsamen Hochzeitsbräuche vergangener Zeiten: Jeder
der beiden Gatten hatte ein Paar Pantoffel an, und es galt für bei,
dem anderen seinen eigenen Pantoffel aufzustellen. Wer dem anderen zuerst
"auf den Fuß getreten" hatte, der galt als Sieger ("Pantoffelheld")
und damit war dem unterlegenen vorausgesagt, daß er nun zeitlebens
unter dem Pantoffel des anderen stehen würde.
Ob diese Weissagung aber einen sicheren Wert darstellte,
wird doch sehr in Zweifel zu ziehen sein.
-
Einen größeren Verlaß stellt es dar,
wenn "jemand auf Nummer Sicher" gesetzt wird. Wer macht das nicht
gerne, auf Nummer Sicher setzen... – Aber Vorsicht, diese Redensart
besagt eigentlich nichts anderes, als jemand ins Gefängnis gesteckt
wird, an dessen Türen Nummern prangen und der Aufenthaltsort für
die Bürger als recht sicher angesehen wurde. – Vor dem da drinnen
war man sich für gewisse Zeit sicher.
-
Zu den Redensarten gehören aber auch die, die genau
genommen nichts ausdrücken wollen, als nur ein Gespräch aktivieren
wollen oder im Fluß halten sollen. Dabei sind Verblüffungseffekte
durchaus zu erwarten und genau das ist dann der Motor für das Gespräch.
Wenn es zum Beispiel in einer (X-beliebige) Mundart heißt: "Das
is‘ ja wohl’n feiner Kerl, näch, und Beene hatta, bis auf die Erde!"
-
Wie sehr sehr Höflichkeitsformen zu Redensarten
geraten sind oder geraten können, wird vielleicht deutlich, wenn folgende
Szene nachempfunden wird:
Hugo ist in großer Eile und dabei unachtsam.
Dabei rempelt er eine Person an, die darum an einer Hausecke derart anstößt,
daß es einen nachhaltigen Schmerz verursacht. Hugo hat diese Folge
seiner Unachtsamkeit mitgekommen, geht auf die Person zu und sagt freundlich
"`schuldigung! – ich habe sie gar nicht gesehen!" was durchaus zutreffen
wird, und Hugo setzt noch eine höfliche Frage nach: "Hat’s denn
weh getan?" – Will er wirklich eine ehrliche Antwort erhalten, er sieht,
doch wie die Person sich die Schulter hält und den Schmerz damit sogar
lokalisieren kann. Aber auch die geschädigte Person ist sehr höflich
und antwortet: "Nein, Danke, es geht schon!" offensichtlich ist
das nicht ganz die Wahrheit, und gegenseitig ist der Höflichkeit Genugtuung
widerfahren. Nun aber setzt Hugo noch einen drauf und will ganz der Lustige
sein: "Schade aber auch!" – Es dauert bei Männern sehr lange
bis diese merken, daß hier gegen die Form gehandelt wird. Und Hugo
kann schon zehn Schritte weitergegangen sein, da merkt die ramponierte
Person erst, daß hier jemand über ihren Zustand einen lockeren
Scherz machen wollte.
Ihren Wert erhält die Abfolge der Redensarten
erst durch die komplette und verläßliche Abfolge der Satzfragmente.
-
An dem Beispiel läßt sich aber auch darstellen,
wie leer inzwischen manch der Redensarten geworden ist. Wie oft wird im
Alltag schlicht "´schuldigung!" gesagt, und gemeint war ursprünglich:
"Ich bitte Dich darum, daß Du mich entschuldigst, mir die Schuld
erläßt, abnimmst!" – aber dazu wird dann überhaupt keine
Chance gegeben, weil doe Kontrahenten sich in den meisten Fällen schon
längst wieder aus dem Blick verloren haben.
-
Eine ähnliche Beobachtung kann der machen, der
als Abschiedsgruß nicht das allseits beliebte "Guten Tach noch!"
oder in der etwas ausführlicheren Form: "Ich wünschen Ihnen einen
guten Tag!"
sondern wenn stattdessen eine eigenständige
Wortwahl getroffen wird, wie zum Beispiel: "Ich wünsche, daß
es für UNS ein schöner Tag wird!" – Allein das "schöner
Tag" wird gehört und schon resoniert der Gegrüßte mit großer
Wahrscheinlichkeit: "Ich Ihnen auch!" – Redensarten haben eben ihre
eigene Dynamik und sie setzen gegenseitig voraus, daß die gewählten
Kürzel gegenseitig verstanden und akzeptiert werden. Und wehe ich
tanze aus der Rolle: "Können Sie mir sagen, wo es zum Bahnhof
geht?" – "Ja!" und weg ist der Befragte – was nun?
-
Und wie furchtbar manche Redensarten in ihren Formulierungen
ich anhören oder sogar auswirken, wird besonders in unserer Zeit deutlich,
in der die Überschwemmung mit Informationen viel vom Leser und Hörer
abverlangt – ob immer das richtige ankommt, muß bezweifelt werden.
Auch wenn es immer und immer wieder so geschrieben wird, es wird damit
nicht wahrer: "Der Krieg in Jugoslawien forderte bislang so und so viele
Todesopfer!" – Der Unsinn dieser Behauptung liegt auf der Hand, aber
er wird einem nicht mehr bewußt, weil das mitgeteilte Grauen gar
nicht die Zeit dafür beläßt. Als wenn das Subjekt "Krieg"
"Forderungen" in Form von Todesopfern formuliert hätte. Deutlich wird,
daß die Verantwortung der Krieg hat – nicht der Mensch, die Menschen.
-
Ähnlich verhält es sich dabei mit den verniedlichenden
Redewendungen – bleibe ich beim "Kriegshandwerk" – wenn bis heute
davon die Rede ist, daß ein Soldat gefallen ist. Wenn Zivilisten
in der gleichen Auseinandersetzung getötet wurden, dann wird es so
zum Ausdruck gebracht. – Trotzdem weiß jeder, was gemeint ist, wenn
solch ein Unsinn ausgesprochen wird.
Wieviele Menschen wurden in den vergangenen Jahren
"freigesetzt", und nicht einfach gekündigt...
-
Es gibt in unserer Zeit aber auch Redewendungen, die
sich vollkommen unreflektiert aus einer Halbinformation entwickelt haben.
Wer von uns würde auf den Gedanken kommen und sagen, "Da mußte
ich doch gestern tatsächlich erst von Martin bis Luther gehen, um
meine Papier zu erhalten!" – aber wieviele Menschen gehen jeden Tag von
Pontius zu Pilatus – vielleicht kommen deshalb so wenig auch wirklich
ans Ziel?
Wenn Redewendungen sich gegenseitig beissen...
Mensch
und Natur im Widerstreit
Oder: Ick bin jerührt wie Appelmus!
Dunkel war’s der Mond schien helle
schneebedeckt die grüne Flur,
als ein Wagen blitzeschnelle
langsam um die Ecke fuhr.
Drinnen saßen stehend Leute,
schweigend im Gespräch vertieft,
als ein totgeschossner Hase
auf der Sandbank Schlittschjuh lief.
Und ein blondgelockter Knabe
mit kohlrabenschwarzem Haar
saß auf einer grünen Banke,
die rot angestrichen war.
Neben ihm ´ne olle Schrulle
so von 16, 17 Jahr
in der Hand ´ne Butterstulle,
die mit Schmalz bestrichen war.
Draußen war es, in der Stuben,
singend sprach die Maid zum Buben:
Holder Engel, süßer Bengel,
vielgeliebtes Trampeltier,
Augen haste wie Sardellen,
alle Ochsen gleichen dir!
Hier die Antwort, könnt ihr’s wähnen,
die er gab mit trocknen Tränen:
Ich bin jerührt wie Appelmus
und flüssig wie Pomade,
mein Herz schlägt wie ein Pferdefuß
in deiner linken Wade!
(Berliner Straßen-Poesie)
In dem nachfolgenden Bericht aus dem Innenleben
eines Vereins sind 32 Wortbilder und Redewendungen versteckt, die bereits
in der Bibel zu finden sind
Bitte
suchen, und unterstreichen
Die "Eintracht"
bestellt ihr Haus
Eine Bericht unserer
Korrespondenten Harry Hirsch
In der Vorstandssitzung
des Fußballvereins "Eintracht" gehen die Wogen hoch. Wegen des schlechten
Tabellenplatzes der Mannschaft will die Mehr der Vereinsleitung den Trainer
in die Wüste schicken. Daß er zum Sündenbock gestempelt
wird, überrascht den Mann jedoch so, daß er zunächst einmal
zur Salzsäule erstarrt. Dann stellt er sich der Kritik. Er könne
nicht zu allem, was ihm vorgeworfen werde, Ja und Amen sagen. Eine ganze
Anzahl der Vertragsspieler sei mehr auf Nebenverdienste konzentriert als
Training und Leistung im Spiel. Bei diesem Tanz um Goldenen Kalb stünden
ihm als Mannschaftsbetreuer die Haare zu Berge.
Der Vorstand macht
dem Trainer darauf den Vorwurf, er wolle seine Hände in Unschuld waschen.
Wenn der Coach sich auf Herz und Niere prüfe, dann müsse er in
Sack und Asche gehe. Der Trainer sollte sich doch viel stärker um
die einzelnen Spieler kümmern, ja, sie wie seinen Augapfel hüten.
Der Attackierte lenkte
nun ein, weil er merkt, daß Unnachgiebigkeit gegenüber dem Vorstand
ein zweischneidiges Schwert ist. Er versichert unverzüglich einen
neuen Versuch unternehmen zu wollen, um der Elf wieder inneren Auftrieb
zu geben. Er will als Trainer nicht der Stein des Anstoßes sein.
Auf Treu und Glauben gibt nun auch der Vorstand nach.
Am nächsten Tag
gibt es ein Gespräch zwischen Spielern und Trainer. "Ich möchte
nicht wie bisher tauben Ohren predigen", sagt er zu ihnen. "Mit Brief und
Siegel gebe ich es euch, daß es so weiter bergab gehen wird. Wenn
vor allem die Sturmspitzen und der rechte Flügel nicht Himmel und
Erde in Bewegung setzen, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als
die Spreu vom Weizen zu trennen. Den ständigen Meckerern muß
ich ganz klar sagen: `Wer Wind sät, wir Sturm ernten.´ "
Vor allem die angesprochenen
jüngeren Spieler nahmen sich den Denkzettel zu Herzen, während
einige der bewährten Stammspieler sich ins Fäustchen lachten.
Es passierte ihnen nie, daß sie ihr Licht unter den Scheffel setzten.
Und was den Vorstand des Vereins betraf, zogen es die altgedienten Spieler
vor, zu ihrem Trainer zu halten, getreu der Devise: "Niemand kann zwei
Herren dienen."
Im nächsten Punktspiel
zeigte sich, daß die Mannschaft die Zeichen der Zeit erkannt hatte.
Keinem Spieler konnte man den Vorwurf machen, er habe in beiden Halbzeiten
sein Pfund vergraben. Auch die Zuschauer trugen ihr Scherflein bei, so
daß der doppelte Punktgewinn allen in bester Erinnerung blieb. Der
Trainer diente seiner abgekämpften Elf wie ein barmherziger Samariter.
Nach dem Spiel, in der Kabine, waren sie wieder ein Herz und eine Seele.
Es war den Spieler
also gut bekommen, daß der Trainer mit Menschen- und mit Engelszungen
geredet hatte. Dem Vorstand fiel es wie Schuppen von den Augen, er erkannte
die Wurzel alles Übels: Man muß in Auseinandersetzungen seine
Zunge im Zaum halten und darf auf niemand den ersten Stein werfen.
© Deutsche
Bibelgesellschaft, Stuttgart, 1982
DIE
LÖSUNG
Die "Eintracht" bestellt
ihr Haus
Eine Bericht unserer
Korrespondenten Harry Hirsch
In der Vorstandssitzung
des Fußballvereins "Eintracht" gehen die Wogen hoch. Wegen des schlechten
Tabellenplatzes der Mannschaft will die Mehr der Vereinsleitung den Trainer
in die Wüste schicken. Daß er zum Sündenbock
gestempelt wird, überrascht den Mann jedoch so, daß er zunächst
einmal zur Salzsäule erstarrt. Dann stellt er sich der Kritik.
Er könne nicht zu allem, was ihm vorgeworfen werde, Ja und Amen
sagen. Eine ganze Anzahl der Vertragsspieler sei mehr auf Nebenverdienste
konzentriert als Training und Leistung im Spiel. Bei diesem Tanz um
Goldenen Kalb stünden ihm als Mannschaftsbetreuer die Haare
zu Berge.
Der Vorstand macht
dem Trainer darauf den Vorwurf, er wolle seine Hände in Unschuld
waschen. Wenn der Coach sich auf Herz und Nieren prüfe,
dann müsse er in Sack und Asche gehe. Der Trainer sollte sich
doch viel stärker um die einzelnen Spieler kümmern, ja, sie wie
seinen Augapfel hüten.
Der Attackierte lenkte
nun ein, weil er merkt, daß Unnachgiebigkeit gegenüber dem Vorstand
ein zweischneidiges Schwert ist. Er versichert unverzüglich
einen neuen Versuch unternehmen zu wollen, um der Elf wieder inneren Auftrieb
zu geben. Er will als Trainer nicht der Stein des Anstoßes
sein. Auf Treu und Glauben gibt nun auch der Vorstand nach.
Am nächsten Tag
gibt es ein Gespräch zwischen Spielern und Trainer. "Ich möchte
nicht wie bisher tauben Ohren predigen", sagt er zu ihnen. "Mit
Brief und Siegel gebe ich es euch, daß es so weiter bergab gehen
wird. Wenn vor allem die Sturmspitzen und der rechte Flügel nicht
Himmel und Erde in Bewegung setzen, dann bleibt mir nichts anderes
übrig, als die Spreu vom Weizen zu trennen. Den ständigen
Meckerern muß ich ganz klar sagen: `Wer Wind sät, wir Sturm
ernten.´"
Vor allem die angesprochenen
jüngeren Spieler nahmen sich den Denkzettel zu Herzen, während
einige der bewährten Stammspieler sich ins Fäustchen lachten.
Es passierte ihnen nie, daß sie ihr Licht unter den Scheffel setzten.
Und was den Vorstand des Vereins betraf, zogen es die altgedienten Spieler
vor, zu ihrem Trainer zu halten, getreu der Devise: "Niemand kann zwei
Herren dienen."
Im nächsten Punktspiel
zeigte sich, daß die Mannschaft die Zeichen der Zeit erkannt
hatte. Keinem Spieler konnte man den Vorwurf machen, er habe in beiden
Halbzeiten sein Pfund vergraben. Auch die Zuschauer trugen ihr
Scherflein bei, so daß der doppelte Punktgewinn allen in bester
Erinnerung blieb. Der Trainer diente seiner abgekämpften Elf wie ein
barmherziger Samariter. Nach dem Spiel, in der Kabine, waren sie wieder
ein Herz und eine Seele.
Es war den Spieler
also gut bekommen, daß der Trainer mit Menschen- und mit Engelszungen
geredet hatte. Dem Vorstand fiel es wie Schuppen von den Augen,
er erkannte die Wurzel alles Übels: Man muß in Auseinandersetzungen
seine Zunge im Zaum halten und darf auf niemand den ersten Stein
werfen.
© Deutsche Bibelgesellschaft,
Stuttgart, 1982